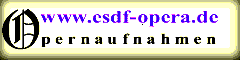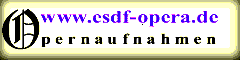Rolle
/ Charakter Gloria
[Sopran]
Aquilantes Tochter Lionetto
de' Ricci [Tenor]
(oft auch Lionello oder Leonello)
Lionetto von Ricci:
genannt "Il Fortebrando"
Ein Söldnerführer (condottiere)
bzw. ein ghibellinischer Hauptmann
— Der Name Ghibellinen ist für das
mittelalterliche Italien die Bezeichnung für die Parteigänger des Kaisers.
http://de.wikipedia.org
1.Fassung
Folco
[Bariton]
2.Fassung
Bardo
[Bariton]
Aquilantes Sohn Aquilante
de' Bardi [Bass]
Aquilante von Bardi:
Mitglied der "Signoria" {Stadtrat
von Siena}
— Als Signoria (Signorie) wird in der historischen Forschung
die Form monokratischer Herrschaftsausübung bezeichnet, die in den Kommunen Ober-
und Mittelitaliens zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert weit verbreitet war. Signoria
bezeichnet dabei die faktische Regierungsform, bei der ein „Herr“ (signore) an
der Spitze stand, ein „starker Mann“. Signoria nannte sich gewöhnlich auch die
Ratsversammlung, die den signore und auch andere Beamte wählte.
http://de.wikipedia.org Il
vescovo [Bass]
Der Bischof La
Senese [Sopran]
Die Sienserin Orvietana
[Mezzo]
Eine Frau aus Orvieto
(In
der 2.Fassung nicht mehr vorhanden) Un
banditore
Ein Ausrufer |
Hintergrund
/ BackgroundZwei
Fassungen:
Nach weiteren Aufführungsserien von "Gloria" in Genua,
Rom und Neapel zog Francesco Cilèa, wohl auf Grund der Reaktionen von Presse
und Publikum, die Oper zurück.
Ettore Moschino [Librettist] wurde mit
einer grundlegenden Überarbeitung des Librettos beauftragt. Die Änderungen
bezogen sich in Akt I auf einige wenige sprachliche Retuschen, in Akt II auf eine
nahezu neue Konzeption und in Akt III auf eine neue Schlußgestaltung. Cilèa
selbst nahm zahlreiche Modifikationen an der Partitur vor. Historische
Geschichte:
.jpg) Die
toskanische Stadt Siena und die historisch-politische Situation des 14.Jahrhunderts
bilden das Zentrum der Oper, während die tragisch endende Liebe zwischen
Gloria und Lionetto zwar ein individuelles Schicksal beschreibt, aber zugleich
Sinnbild dieser allgemeinen Situation ist. Darüber hinaus wird das an der
historischen Realität orientierte Sujet auf die aktuelle politische Situation
der 1910er Jahre in Italien rückgebunden. Die historische Oper avanciert
zur Parabel. Gerade diese inhaltliche Zielsetzung aber ist insofern in der Endfassung
relativiert, als der politische Konflikt gleichsam verkürzt und ins Private
umgebogen wird. (...) Die
toskanische Stadt Siena und die historisch-politische Situation des 14.Jahrhunderts
bilden das Zentrum der Oper, während die tragisch endende Liebe zwischen
Gloria und Lionetto zwar ein individuelles Schicksal beschreibt, aber zugleich
Sinnbild dieser allgemeinen Situation ist. Darüber hinaus wird das an der
historischen Realität orientierte Sujet auf die aktuelle politische Situation
der 1910er Jahre in Italien rückgebunden. Die historische Oper avanciert
zur Parabel. Gerade diese inhaltliche Zielsetzung aber ist insofern in der Endfassung
relativiert, als der politische Konflikt gleichsam verkürzt und ins Private
umgebogen wird. (...)
Die zweite Fassung von Ettore Moschino greift in
zwei Aspekten nachhaltig in die ursprüngliche Konzeption des Librettos ein.
Die Auseinandersetzung zwischen Bardo und Gloria im zweiten Akt wird erweitert,
während der Auftritt Lionettos mit den Offizieren und damit das machtpolitische
Element in der Figur des Protagonisten eleminiert ist. Darüber hinaus erscheint
die politische Motivation der Handlung im zweiten Akt beseitigt, denn Bardo wird
nicht gefangengenommen und er trifft insofern nicht mit seinem Kontrahenten zusammen,
der ihm verzeiht. Der Schluß des zweiten Aktes gerinnt einzig zu einem Liebesduett.
(...)
Während in der 1.Fassung der öffentliche Raum des Doms in
Siena den szenischen Rahmen bildet, wird die Handlung in der 2.Fassung in die
'private' Kapelle der Bardi verlegt. Insofern realisiert Ettore Moschino in seiner
Umarbeitung auch szenisch eine Verschiebung von der übergreifenden historischen
Bedeutung der Handlung hin zu einem privaten Konflikt.
Quelle: H.-J.Wagner
"Fremde Welten" 1999 Hörbeispiele:
96 kbit/s, MP3
* Gloria —› O
mia cuna...
Margherita Roberti [Sopran]
08.07.1969 Turin RAI  2:49 Min
2:49 Min
Renée Fleming [Sopran]
08.2008  3:17 Min
3:17 Min **
Lionetto —› Pur dolente son io...
Flaviano
Labò [Tenor]
08.07.1969 Turin RAI  2:34 Min
2:34 Min |